
Foto: Michael Wallmüller
»Deutschland wird sich in den kommenden Jahren zur militärischen Drehscheibe entwickeln. Damit das funktioniert, braucht es die Wirtschaft als verlässlichen Partner.«
Oberst Daniel Decker
Wirtschaft im Verteidigungsmodus
Mit dem »Operationsplan Deutschland« reagiert die Bundeswehr auf die veränderte sicherheitspolitische Lage in Europa und auf konkrete Anforderungen der NATO. Das fortlaufend weiterentwickelte Strategiepapier umfasst neben der Landes- und Bündnisverteidigung auch die Zusammenarbeit mit zivilen Stellen im Spannungs- und Verteidigungsfall – mit weitreichenden Auswirkungen auf die Wirtschaft.
»Wir befinden uns nicht im Krieg, aber auch nicht mehr im Frieden«, sagt Oberst Daniel Decker und blickt aus dem Fenster des Besprechungsraums in der Kurt-Schumacher-Kaserne in Hannover. Dort hebt gerade ein Bagger ein Loch für neue Rohrleitungen aus. Große Teile der Liegenschaft, in der Decker als stellvertretender Kommandeur des Landeskommandos Niedersachsen tätig ist, sind in diesen Tagen Baustelle. Das Gebäude aus den dreißiger Jahren wird umfassend modernisiert, erweitert und an die veränderten Anforderungen der Bundeswehr angepasst.
Die Baustelle ist dabei auch Sinnbild für das, was in Deutschland gesamtgesellschaftlich geschieht: Die lang gepflegte Hoffnung, Kriege in Europa gehörten der Vergangenheit an, hat sich als Irrtum erwiesen. Die Bundesrepublik rüstet wieder auf. Nicht nur zur Landesverteidigung, sondern vor allem, um ihren Verpflichtungen als NATO-Mitglied gerecht zu werden.
»Deutschland wird kein Frontstaat sein, sondern militärische Drehscheibe«, erklärt Decker. Wenn NATO-Truppen in östliche Bündnisstaaten wie Polen oder das Baltikum verlegt werden, führt ihr Weg in vielen Fällen über deutsches Staatsgebiet. »Das hat direkte Auswirkungen auf unsere Infrastruktur und auf die Unternehmen.« Bereits heute sind die ersten Veränderungen spürbar. Infrastrukturprojekte, Straßenplanung und logistische Knotenpunkte werden auf ihre militärische Nutzbarkeit hin geprüft. »Wir sprechen zum Beispiel mit dem niedersächsischen Verkehrsministerium ganz konkret darüber, welche Straßen wir im Ernstfall nutzen müssten und in welchem Zustand diese sein sollten.«

Norddeutschland als militärische Drehscheibe: Panzer der 4. US-Infanteriedivision werden über Bremerhaven nach Polen verlegt
Foto: Alyssa Bier

Gemeinsame Übungen: Bundeswehr und Polizei trainieren auch gemeinsam für den Ernstfall.
Foto: Anne Weinrich
Ein Paradigmenwechsel für die Wirtschaft
Auch mit Wirtschaftsverbänden ist die Bundeswehr im intensiven Austausch, um für die Auswirkungen des Plans zu sensibilisieren. »Wenn Militärkolonnen auf der Straße oder Schiene unterwegs sind, stehen diese Verkehrswege der Wirtschaft nur eingeschränkt zur Verfügung.« Unternehmen müssten daher Antworten auf neue Fragen finden: Wie reagieren wir, wenn Verkehrswege nur teilweise nutzbar sind? Wie sichern wir unsere Lieferketten ab? »Das betrifft nicht nur Großkonzerne, sondern auch mittelständische Betriebe, insbesondere in Industrie, Logistik und Maschinenbau. Decker betont, dass diese Veränderungen kein reines Krisenszenario darstellen, sondern sich zunehmend im Alltag bemerkbar machen werden. Bereits jetzt führt die Bundeswehr regelmäßig groß angelegte Übungen durch, bei denen das Verlegen von Fahrzeugen, Material und Personal im Mittelpunkt steht.
Für Unternehmen bedeutet der »Operationsplan Deutschland« also einen Paradigmenwechsel und fordert ihre Resilienz heraus. Wer auf Just-in-Time-Lieferungen angewiesen ist oder Mitarbeitende beschäftigt, die als Reservisten dienen, muss langfristig umdenken. Aktuell sind etwa 60.000 Reservisten in der Bundeswehr tätig. Laut Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius soll ihre Zahl in den kommenden Jahren auf 200.000 steigen. »Diese Menschen haben zivile Berufe, und wir sind darauf angewiesen, dass ihre Arbeitgeber sie für Übungen und Einsätze freistellen«, sagt Decker. Das funktioniere allerdings nur, wenn Unternehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung anerkennen, nicht nur gegenüber der Bundeswehr, sondern auch gegenüber anderen Heimat- und Katastrophenschutzorganisationen wie Feuerwehr, THW oder DRK, in denen sich viele Menschen nebenberuflich engagieren.
Was braucht die Bundeswehr?
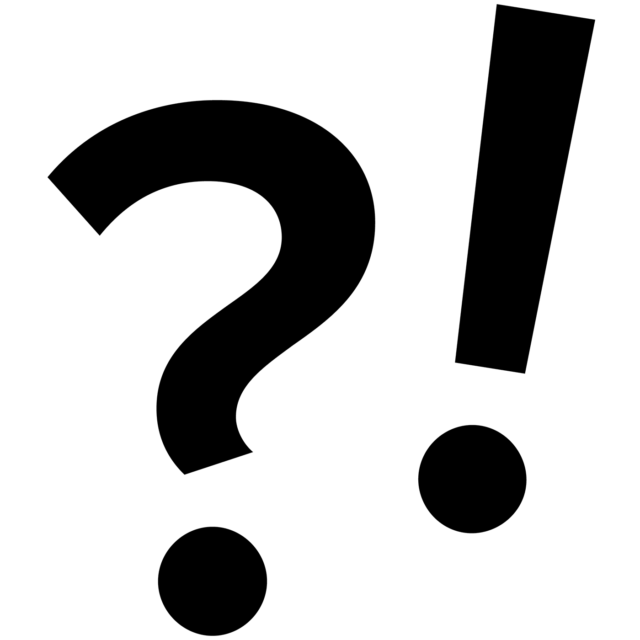
Die deutschen Streitkräfte haben in fast allen Bereichen Nachholbedarf. So fehlt es neben klassischem Gerät wie Panzern und Flugzeugen vor allem an Munition. Wollen Deutschland und Europa unabhängiger von den USA werden, geht es zudem um das Erlangen militärischer Fähigkeiten, die im Nato-Verbund bislang die USA gestellt haben. Dazu gehören unter anderem die Satellitenaufklärung, Raketen mit großer Reichweite und Luftverteidigung. Zusätzlich will die Bundeswehr nun bewaffnete Drohnen in die Truppe einführen, lange Zeit ein politisches Tabuthema. Angesichts der Bedrohungslage drängt die Zeit – bei allen Rüstungsvorhaben. Experten und Geheimdienste warnen, dass Russland bereits 2029 zu einem größeren Krieg und einem Angriff auf Nato-Territorium fähig sein könnte.
Was und wie schnell kann die deutsche Industrie liefern?
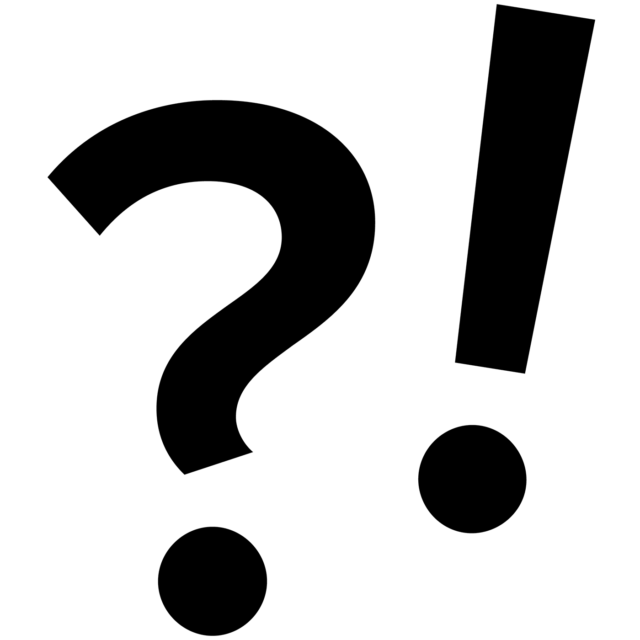
In drei Jahrzehnten der Abrüstung sind die Kapazitäten der deutschen Rüstungsindustrie stark heruntergefahren worden. Wenn die Verteidigungsanstrengungen nun verdoppelt werden sollen, geht das nicht aus dem Stand. Wichtig für einen kontinuierlichen Aufwuchs sind verlässliche Perspektiven. So fordert Hans Christoph Atzpodien, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV), »klare Ansagen« für seine Branche. »Die Industrie kann das allermeiste liefern, wenn ihr klar gesagt wird, was jetzt wovon in welcher Stückzahl und welcher Zeit benötigt wird.« Die Produktion von Munition wird bereits hochgefahren. Bei Drohnen könnten Produktionskapazitäten wohl relativ schnell aufgebaut werden. Bestehende Fähigkeitslücken Europas, für die eigene Systeme noch zu entwickeln sind, wird man innerhalb weniger Jahre nicht schließen können.
In der Bevölkerung wächst das Interesse an der Bundeswehr
Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine beobachtet Decker nicht nur ein wachsendes sicherheitspolitisches Bewusstsein, sondern auch eine gestiegene Bereitschaft, sich im Heimat- und Katastrophenschutz einzubringen. »Immer mehr Bürgerinnen und Bürger interessieren sich für die sogenannte ›Ausbildung Ungedienter‹ – das sind Menschen, die keinen Wehrdienst geleistet haben, aber sagen: ›Ich möchte mein Land schützen.‹« Sie absolvieren eine verkürzte, modularisierte Grundausbildung neben dem Beruf. Reservistinnen und Reservisten sollten idealerweise rund 15 Tage pro Jahr für Übungen und Ausbildungen einplanen. »Viele davon finden an Wochenenden statt, trotzdem ist die Unterstützung durch die Arbeitgeber essenziell«, betont Decker.
Die Bundeswehr strebt daher gezielt Kooperationsvereinbarungen mit Unternehmen an, die die Reserve aktiv unterstützen wollen. Zusätzlich bietet sie einwöchige Informationsübungen für Führungskräfte ohne militärischen Hintergrund an, um die Strukturen und Anforderungen der Bundeswehr besser kennenzulernen. Das Angebot stößt auf positive Resonanz. »Immer mehr Unternehmen erkennen die Bedeutung der Reserve für die gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge – und damit auch für die Stabilität des Wirtschaftsraums Europa«, sagt Decker. »Den Menschen wird bewusst, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, so zu leben und zu arbeiten, wie wir es gewohnt sind.«

Durch die veränderte sicherheitspolitische Lage kein seltener Anblick mehr: Bundeswehr-Kolonnen auf deutschen Autobahnen
Foto: Marco Dorow

Ein Paradigmenwechsel: Oberst Daniel Decker erklärt, was der Operationsplan Deutschland für die Wirtschaft bedeutet.
Foto: Michael Wallmüller
Die Wirtschaft als verlässlicher Partner
Wie bedroht unsere Werteordnung tatsächlich ist, zeigt sich auch an den zunehmenden Angriffen auf zivile Strukturen. Sabotage, Ausspähung und Cyberattacken richten sich längst nicht mehr nur gegen militärische Einrichtungen.
»Wir erleben in Niedersachsen eine drastische Zunahme unerlaubter Drohnenüberflüge über Kasernen«, berichtet Decker. »Aber auch Industrieanlagen, Energieinfrastruktur und Unternehmen sind zunehmend im Visier.«
Deshalb ruft er Unternehmen dazu auf, sich frühzeitig strategisch auf die veränderte Sicherheitslage einzustellen. Nicht mit Alarmismus, aber mit klarem Blick auf mögliche Szenarien. »Wenn die NATO Truppen durch Deutschland verlegt, ist das ein politisches Signal. Aber damit es wirken kann, muss die Drehscheibe funktionieren. Dafür braucht es die Wirtschaft als verlässlichen Partner.«

Foto: Getty Images (Wicki58)
Schnupper-»Wehrdienst« für Führungskräfte
Führungskräfte, die die Bundeswehr besser kennenlernen möchten, haben die Möglichkeit, an einwöchigen dienstlichen Veranstaltungen zur Information teilzunehmen. Die Programme bieten einen kompakten Einblick in den Alltag der Truppe, von der Einkleidung über Geländetraining bis hin zur Schießausbildung. »Bei diesen Informationswochen können Führungskräfte sich ein Bild von der Bundeswehr machen, um besser zu verstehen, was unsere Reservistinnen und Reservisten leisten«, erklärt Oberst Decker.
Die Übungen werden von verschiedenen Teilstreitkräften angeboten – Heer, Luftwaffe, Marine oder Feldjäger. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind allerdings begrenzt.
- Zielgruppe: Führungskräfte aus Wirtschaft, Verwaltung und öffentlichen Einrichtungen
- Dauer: 1 Woche
- Weitere Informationen: gibt es auf der Website der Bundeswehr oder beim zuständigen Landeskommando.
























