Milliarden für den Wasserstoff
Beim Umbau zur klimaneutralen Wirtschaft gilt Wasserstoff als großer Hoffnungsträger. Das ist das Gas aber nur, wenn man es mithilfe von Ökoenergie erzeugt.
Wasserstoff spielt eine wichtige Rolle, um Industrie und Energieerzeugung klimaneutral umzubauen. Bund, Länder und EU haben deshalb in diesem Jahr 4,6 Milliarden Euro für deutsche Wasserstoffprojekte bereitgestellt. Mit den Milliarden will man die Produktion von grünem Wasserstoff vorantreiben, innovative Wasserstoffspeicher schaffen, den Bau von Wasserstoff-Pipelines unterstützen und Lösungen für den Wasserstofftransport – etwa in Form von Ammoniak – entwickeln. Der Großteil des Wasserstoffs soll importiert werden. Dafür sollen fünf Importkorridore entstehen – die ersten Pipelines aus Dänemark und den Niederlanden gehen voraussichtlich schon 2027/28 in Betrieb.
Die Wege des Wasserstoffs
Allein das kürzlich genehmigte Wasserstoff-Kernnetz erfordert Investitionen von rund 19 Milliarden Euro. 2032 soll es in Betrieb gehen. Die Importkorridore sind für 2040 geplant. Vorgesehen sind Importe von bis zu 380 Milliarden Kilowattstunden im Jahr, und zwar auf diesen Wegen: über die Nordsee für Importe aus Dänemark, Großbritannien, Belgien und den Niederlanden, über die Ostsee aus Finnland und aus Offshore-Gebieten, über den Südostkorridor aus dem Nahen Osten, über den Südkorridor aus Algerien und Tunesien sowie den Südwestkorridor für Wasserstoff aus Spanien und Portugal.
Was ist Wasserstoff?
Wasserstoff (Symbol: H) ist das häufigste chemische Element im Universum. Es ist Bestandteil von Wasser und den meisten organischen Verbindungen. Es ist zudem das leichteste Element und etwa 14-mal leichter als Luft. Unter normalen Bedingungen tritt es als sehr flüchtiges, farb- und geruchloses Gas (H2) auf. Das durchdringt viele Materialien. Unter anderem deshalb sind Transport und Lagerung von Wasserstoff technisch anspruchsvoll. Außerdem ist Wasserstoff hochentzündlich und damit ein Gefahrstoff. Bei Kontakt mit Luft kann es leicht zu einer Knallgasexplosion kommen. Um Wasserstoff zu verflüssigen, bedarf es extremer Kälte: minus 253 Grad Celsius. In diesem Zustand hat er die höchste Speicherdichte und den größtmöglichen Energiegehalt. Er lässt sich dann platzsparend befördern, das stellt aber hohe Anforderungen an die Kryotanks (tiefkalte Speicher). Klimaneutral erzeugter Wasserstoff gilt als Schlüsselelement der Energiewende – aber es braucht Lösungen, um ihn zu transportieren.
Das Wasserstoff-Kernnetz in Deutschland und die Importkorridore
9.040 Kilometer Rohrleitungen sollen bis 2032 Industrie, Speicher und Kraftwerke mit dem Gas versorgen
Quellen: Bundesnetzagentur; BMWK
Die Farben des Wasserstoffs
Grün: Der Wasserstoff wird per Elektrolyse aus Wasser hergestellt, und zwar allein mit Strom aus erneuerbaren Energien. Treibhausgase entstehen dabei nicht.
Pink: Per Elektrolyse produzierter Wasserstoff. Der Strom für den Prozess kommt allerdings aus Kernkraftwerken. Das erzeugt zwar keine Treibhausgase, hat dafür aber andere Umweltnachteile.
Grau: Dieser Wasserstoff wird aus fossilen Energien, in der Regel Erdgas, erzeugt. Als ein Nebenprodukt entsteht dabei das Treibhausgas Kohlendioxid. Als grau wird Wasserstoff auch bezeichnet, wenn der benötigte Strom aus dem Netz kommt, also zum Teil aus fossilen Kraftwerken.
Türkis: Das ist Wasserstoff, der durch die sogenannte Methanpyrolyse bei 700 bis 1.000 Grad Celsius aus Methan erzeugt wird, dem Hauptbestandteil von Erdgas. Dabei entstehen Wasserstoff sowie Kohlenstoff in fester Form, aber kein Klimagas. Den Kohlenstoff nutzt man anderweitig oder entsorgt ihn.
Blau: Er wird wie grauer Wasserstoff gewonnen, das entstehende Kohlendioxid aber abgefangen und unterirdisch gespeichert. Auch Wasserstoff, der auf Biogas statt auf Erdgas basiert, gilt als blauer Wasserstoff.
Weiß: Dieser Wasserstoff fällt als Nebenprodukt in chemischen Prozessen an. Weißer Wasserstoff entsteht auch geochemisch in der Erde. Natürliche Vorkommen gibt es zum Beispiel in Afrika.
Kleines H2-Glossar
Ammoniak:
Gasförmige Verbindung (NH3) aus Stickstoff (N) und Wasserstoff (H). Ammoniak lässt sich leichter transportieren als Wasserstoff: Es hat eine höhere Energiedichte und ist weniger entzündlich. Aber auch für das Gefahrgut Ammoniak gelten strenge Transportvorschriften. Die Umwandlung von Wasserstoff in Ammoniak und wieder zurück ist mit Energieaufwand verbunden. Deutschland hat im Sommer einen ersten Liefervertrag für Wasserstoff aus dem Ausland abgeschlossen: Bis 2032 sollen über 259.000 Tonnen Ammoniak per Schiff aus Ägypten kommen.
LOHC:
Liquid-organic hydrogen carrier (flüssige organische Wasserstoffträger) sind ölartige Substanzen, die Wasserstoff binden. Sie dienen als Trägermaterial, um den Wasserstoff sicherer und einfacher – ohne Herunterkühlen und ohne extremen Druck – über längere Strecken zu transportieren. Die bestehende Öl-Logistik, etwa Tankwagen, ist für den Transport geeignet. Allerdings verbrauchen sowohl das Speichern des Wasserstoffs im Trägermittel als auch das Freisetzen nach dem Transport Energie.
Brennstoffzelle:
Den Strom für die E-Mobilität kann man auch mit einer Brennstoffzelle aus Wasserstoff erzeugen. Dabei entsteht durch eine elektrochemische Reaktion aus Wasserstoff und Sauerstoff der Strom für das Auto. Als Nebenprodukt bildet sich Wasser. Es gibt verschiedene Brennstoffzellentypen, je nach verwendetem Gas, Zelleigenschaften, Betriebstemperatur und erzeugter Leistung. Manche Zelltypen nutzen Methanol oder Erdgas als Brennstoff.
Methanol:
Flüssiger, leicht entzündlicher Alkohol mit der Summenformel CH3OH. Er gilt in der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung ebenso wie Ammoniak als besser transportfähiges Derivat, zumindest über weite Entfernungen hinweg. Ein entsprechendes Förderprojekt mehrerer Fraunhofer-Institute findet in Chile statt. Am Bestimmungsort in Deutschland angekommen, muss Methanol dann rückverwandelt werden, um wieder Wasserstoff zu gewinnen.
Elektrolyse:
Sie ist bisher das Verfahren, um klimaneutral Wasserstoff zu erzeugen. Dabei gewinnt man mithilfe von Strom aus Wasser (H2O) Wasserstoff und Sauerstoff. Voraussetzung ist allerdings der Einsatz von Strom aus Wind, Sonne oder Wasserkraft. Die Elektrolyse ist das Gegenstück zur Reaktion in der Brennstoffzelle.
Naphtha:
Naphtha, auch Rohbenzin genannt, wird aus Erdöl gewonnen, ist ein Gemisch aus Kohlenwasserstoffen und ein sehr wichtiger Rohstoff für Chemiebetriebe und Raffinerien. In Zukunft könnte man Naphtha auch aus im Kreislauf geführtem Klimagas und Wasserstoff synthetisch erzeugen. So würde Wasserstoff der Chemieindustrie eine neue Rohstoffbasis verschaffen.
Der »Champagner unter den Energieträgern«
Wasserstoff ist brennbar und lässt sich ähnlich wie Erdgas als Energieträger verwenden. Beim Verbrennen mit Sauerstoff setzt er nur Wasserdampf frei. Er gilt deshalb als »Champagner unter den Energieträgern«. Aber: Der Aufwand für Gewinnung und Transport ist sehr hoch. Das mindert den Wirkungsgrad. Sinnvoll ist der Einsatz nur da, wo man Strom aus Wind und Sonne nicht direkt nutzen kann.
Hier ist Wasserstoff sinnvoll
Schwerlastverkehr: Bei Lastwagen punktet der Energieträger Wasserstoff mit schnellem Tanken, hoher Reichweite trotz schwerer Transportlasten und geringem Gewicht.
Flug- und Schiffsverkehr: Flüssige synthetische Kraftstoffe auf Basis von Wasserstoff sind hier voraussichtlich die Energieträger der Zukunft.
Stahlerzeugung: Hier soll Wasserstoff die Kohle als Reduktionsmittel ersetzen. So lässt sich aus Erz Stahl gewinnen, ohne Klimagas freizusetzen.
Chemieindustrie: Sie braucht Wasserstoff als Rohstoff, zum Beispiel für die Düngemittelherstellung. Bisher kommt er meist aus Erdgas. Grüner Wasserstoff ist eine nachhaltige Alternative.
Hier sind Alternativen besser
Pkws: Bei Autos ist es effizienter, mit Batterien zu fahren und den Strom direkt für den Elektromotor zu nutzen. Mit grünem Strom erst Wasserstoff oder künstliche Treibstoffe fürs Fahren zu erzeugen, frisst sehr viel Energie.
Heizen: Die Wärmepumpe nutzt grünen Strom direkt, während der Energieträger Wasserstoff zum Heizen erst aufwendig mit Strom erzeugt werden muss. Zudem hat die Wämepumpe einen viel höheren Wirkungsgrad als die Brennstoffzellen-Heizung.
Wasserarme Regionen: Weil man zum Erzeugen von grünem Wasserstoff Wasser braucht, kann es in trockenen Regionen zu Konflikten mit anderen Nutzungen von Wasser kommen.
»Man braucht nicht so viel Zeit, um Lösungen auf den Markt zu bringen.«
Ulrich Giese, Professor für Elastomerchemie am Deutschen Institut für Kautschuktechnologie

Foto: DIK
»Ein Leck wäre fatal«
Ohne Dichtung wird es nichts mit der Wasserstoff-Wirtschaft.
Forschungseinrichtungen und Kautschuk-Unternehmen stehen aktuell unter Innovationsdruck. Sie arbeiten intensiv an Neuheiten für die künftige Wasserstoff-Wirtschaft. Dazu entwickeln sie Lösungen, damit sich der flüchtige und explosive Wasserstoff lagern und transportieren lässt. Ulrich Giese, Professor am Deutschen Institut für Kautschuktechnologie (DIK), erklärt, worum es da geht.
Die Wasserstoffwirtschaft braucht Elastomere. Bei Elektrolyseuren, in Tanks, Leitungen und Brennstoffzellen sind sie als Dichtungen im Einsatz. Auch in Ventilen oder Membranen spielen sie eine Rolle. Den extremen Belastungen bei Transport und Speicherung von Wasserstoff (H2) halten aber nur sehr spezielle Werkstoffe oder Werkstoffkombinationen stand. Die Herausforderungen sind:
- das rasche Diffundieren der äußerstleichten und kleinen Wasserstoffmoleküle,
- chemische Reaktionen mit Kunststoffen,
- die Beeinträchtigung von Metallen (Wasserstoffkorrosion),
- das Speichern unter starkem Druck von bis zu 1.000 Bar,
- die spätere Entspannung und Ausdehnung beim Ableiten des Wasserstoffs sowie
- Temperaturen von mindestens minus 253 Grad in Kryotanks, in denen verflüssigter Wasserstoff befördert wird.
Förderbank finanziert Entwicklung extrem gasdichter Elastomere
Ab einer bestimmten Wasserstoffkonzentration in der Luft können Funken oder Entladungen von elektronischen Bauteilen zu einer Explosion führen. Professor Giese vom DIK stellt fest: »Ein Leck wäre fatal.«
Der Experte forscht an Lösungen für den Transport und die Speicherung von Wasserstoff. Auch die Alterung von Dichtungsmaterialien ist ein Thema. Stahltanks und -rohre brauchen eine Schutzschicht, weil Metall unter dem Einfluss von Wasserstoff korrodieren kann. Diese Schutzschichten müssen wegen der auftretenden Druck- und Temperaturschwankungen flexibel sein – starre Systeme könnten reißen.
Hier kommt Gummi ins Spiel. In einem von der niedersächsischen Förderbank NBank finanzierten Projekt entwickeln das DIK und seine Partner einen Werkstoffverbund, der dicht hält, nicht versprödet und auch bei wechselnden Belastungen nicht ermüdet. Synthetischer Butylkautschuk oder auch Fluorkautschuk, erklärt der Institutsleiter, eignen sich als sehr gasdichte Ausgangsmaterialien. Füllstoffe wie Schichtsilikate und grafitbasierte Materialien erhöhen die Sperrwirkung enorm. Das macht die Werkstoffe beispielsweise für Dichtungen in Brennstoffzellen, Verbindungen von Leitungen oder ganz klassisch als O-Ringe einsetzbar. Um entsprechende Elastomerbauteile und -werkstoffe herzustellen, kann man im Prinzip auf bestehende Prozesse zurückgreifen. Das sei praktisch, sagt der Professor: »Man braucht nicht so viel Zeit, um solche Lösungen auf den Markt zu bringen.«
Langzeittests für die Alterung der Materialien muss man noch entwickeln
Andere Fragen lassen sich aber nur in Langzeitversuchen klären, etwa wie die Alterung von Materialien im Kontakt mit Wasserstoff abläuft. »Testmethoden, die diese Prozesse im Zeitraffer abbilden, muss man erst mal entwickeln beziehungsweise optimieren«, sagt Giese. Zeitaufwendig ist aus Sicht des Experten auch die Sanierung der bestehenden Leitungsnetze: »Sie in ihrem jetzigen, teilweise alten und maroden Zustand für Wasserstoff zu nutzen, wäre äußerst riskant. Um die Gasversorgung wasserstofftauglich zu machen, wäre nach Prüfung der Leitungen in vielen Fällen vermutlich eine aufwendige Sanierung erforderlich.«
Neue Abteilungen tüfteln an Lösungen für Wasserstoff
Gerade in der Industrie gebe es viel Erfahrung mit Pipelines, die seit Jahrzehnten unfallfrei explosive Stoffe transportieren. »Zwar sind Wasserstofftechnologien speziell«, sagt Giese, »aber die Großindustrie ist in der Lage, das zu stemmen.« Auch kleine und mittelständische Unternehmen interessieren sich sehr für neue Produkte, beispielsweise wasserstofftaugliche Hochdruckventile. Und die Elastomerbranche reagiert auf die große Nachfrage: »Bei vielen großen Dichtungsherstellern gibt es inzwischen eigene, neue Abteilungen, die sich mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen«, berichtet Giese. Denn nicht nur der Transport von reinem Wasserstoff erfordert Innovationen. Auch Tanks und Brennstoffzellen, etwa in Elektroautos, müssen sicher sein.
Das gilt auch für den Umgang mit Wasserstoff-Trägermaterialien wie Ammoniak oder Methan, die bald in großen Mengen auf Straßen und Wasserwegen ankommen und in Flugzeugen benötigt werden. Giese: »Das Problem der Dichtigkeit muss für alle Bereiche der Wasserstoffwirtschaft gelöst werden.«

Foto: Trelleborg Sealing Solutions
»Lecks senken den Wirkungsgrad von Wasserstoff. Das ist Motivation genug für effizientere Dichtungen.«
Daniel Hauser, Manager Global Lead Group Hydrogen bei Trelleborg Sealing Solutions
Wasserstoff-Innovationen brauchen maßgeschneiderte Tests
Die Werkstoffpalette von Trelleborg Sealing Solutions bietet Lösungen für Transport und Speicherung von Wasserstoff.
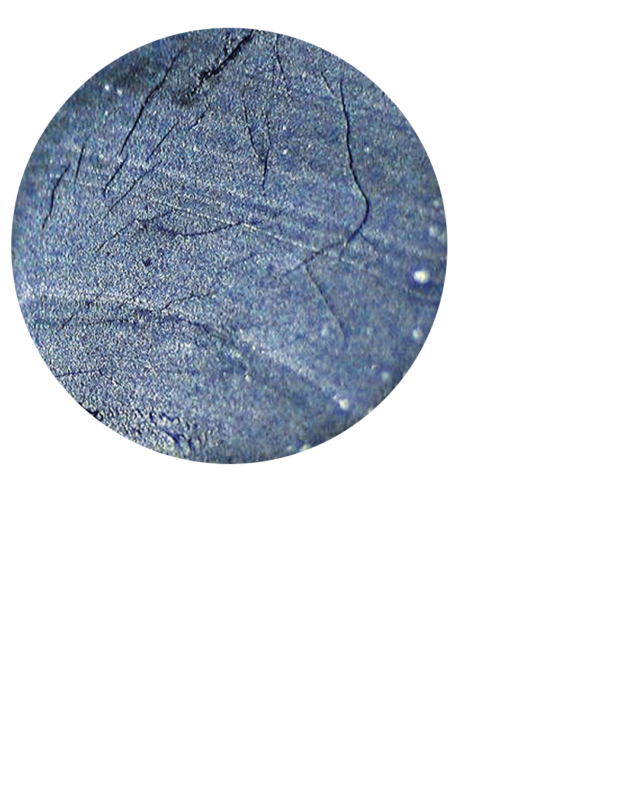

Die neuen Werkstoffe aus der Marke »H2Pro« (unten) verhindern Risse (oben)‚ die beim Betanken von Wasserstoff-Autos entstehen können.
Fotos: Trelleborg Sealing Solutions (2)
Der Dichtungsspezialist Trelleborg hat unter der Dachmarke »H2Pro« spezielle Werkstoffe für die Wasserstoffwirtschaft entwickelt und im Sommer vorgestellt. »Es gibt nicht den einen Werkstoff, der alle Dichtungslösungen für Wasserstoffanwendungen abdeckt«, erklärt Daniel Hauser, Manager Global Lead Group Hydrogen des Unternehmens mit Hauptsitz in Stuttgart. Darum umfasst die neue Dachmarke mehr als 20 Produkttypen, weitere sind geplant.
Das Besondere daran: Trelleborg hat sie über die geltenden Normen hinaus intensiv getestet. »Wir haben beispielsweise die Reaktion auf plötzliche Druckentlastung geprüft, wie sie beim Betanken von Wasserstofffahrzeugen passiert«, berichtet der Experte. Das ist eine kritische Situation, denn dabei kann es zur sogenannten Rapid Gas Decompression kommen, die die Dichtung zerstört. Weitere, Tausende von Dichtungstests bei unterschiedlichen Drücken und Temperaturen vertieften das Wissen über die Produkttypen.
Sie sind für verschiedene Anwendungen gedacht, etwa für Regler und Ventile, Tankanschlüsse, Transportbehälter und Speicher sowie in Brennstoffzellen und Elektrolyseuren. »Aus diesen Anwendungsfeldern kam sofort eine rege Nachfrage«, berichtet Hauser. Für 2025 erwartet er, dass der dynamische H2-Markt weiter wächst und damit auch das Trelleborg-Portfolio.
Der Dichtungsspezialist Trelleborg sieht es als kritisch an, dass die Normen, die für Hochdruckgase im Öl- und Gassektor verwendet werden, den Bedingungen einer H2-Anwendung nicht optimal entsprechen. Darum hat das Unternehmen in diesem Jahr in Fort Wayne (Indiana, USA) ein eigenes Wasserstoff-Testzentrum eröffnet. Hier untersuchen Werkstoff-Spezialisten und Prüfingenieure die Materialien unter anderem auf Druck, Verträglichkeit, Beständigkeit und Leckage. Dabei geht es nicht nur um den Werkstoff an sich, sondern auch um sein Verhalten in bestimmten Bauteilen und in der Brennstoffzelle. »Bei unseren Kunden ist das Interesse groß«, sagt Hauser. »Denn externe Labore sind teuer und haben Wartezeit. Unser Testzentrum ist da im Vorteil, wenn es gilt, zusammen mit den Kunden zügig neue Lösungen zu entwickeln.«
»Wasserstoff ist sehr flüchtig, deshalb muss ein Ventil für eine Brennstoffzelle hohe Anforderungen erfüllen.«
Klaus Kirchheim, Geschäftsführer des Magnetventilherstellers nass magnet

Foto: Raphael Laschke – nass magnet
»Grünen Strom ineffizient zu nutzen ist immer noch besser, als ihn nicht zu produzieren«
Der Magnetventilhersteller nass magnet produziert Ventile für Tanksysteme und Brennstoffzellen.
Mithilfe von Brennstoffzellen Strom aus Wasserstoff zu erzeugen, galt lange Zeit als unsinnig, da der Vorgang sehr viel Energie verbraucht. Obwohl die Forschung mittlerweile bessere Ergebnisse erzielt, bleibt am Ende eines Umwandlungsprozesses von Strom zu Wasserstoff und zurück nur noch rund ein Drittel der eingesetzten Energie übrig. Dennoch interessiert sich die Industrie zunehmend für das Verfahren. Aus gutem Grund: Die Technologie kann Sektoren elektrifizieren, in denen der Einsatz von Batterien nur schwer bis gar nicht möglich ist.

Anodeventil zum Ablassen von Nebenprodukten wie Wasser bei Wasserstoffanwendungen
Foto: nass magnet
»Der Schwerlastverkehr ist ein gutes Beispiel, aber auch die Schifffahrt und der Flugverkehr«, sagt Klaus Kirchheim, Geschäftsführer des Magnetventilherstellers nass magnet. Im Schwerlastverkehr würde sich die Nutzlast durch das Gewicht der Batterien so stark verringern, dass für die Frachtgutmenge von zwei Lkw künftig drei Lkw nötig wären. »Das ist in keiner Weise effizient. Weder für die Umwelt, noch für das Verkehrsaufkommen oder die Spedition«, sagt Kirchheim.
Kritikern der Brennstoffzellentechnologie hält Kirchheim entgegen, dass der Energieverlust durch das Brennstoffzellenverfahren im Grunde gar kein echter Verlust ist. »Momentan werden Solar- und Windkraftanlagen abgeschaltet, wenn es zu wenig Abnehmer für den produzierten Strom gibt. Dann geht der Grüne Strom nicht verloren, er wird gar nicht erst produziert.« Sinnvoller wäre es aus seiner Sicht, Solaranlagen und Windräder weiter Strom produzieren zu lassen, diesen in Wasserstoff umzuwandeln und ihn zu speichern, bis er gebraucht wird. »Das Verfahren mag energietechnisch ineffizient sein, aber immerhin nutzen wir einen Teil des ansonsten verlorenen Grünen Stroms.«
Nachdem sich die Ampel-Regierung zuletzt zunehmend positiv gegenüber dem Verfahren gezeigt hat, schwindet auch die Unsicherheit in der Industrie. Das kann Kirchheim bestätigen. Sein Unternehmen hat Magnetventile für Wasserstofftanks und Brennstoffzellen entwickelt. »Es gelten hohe Anforderungen an solche Ventile. Wasserstoff ist hoch flüchtig, deshalb müssen Ventile für die Speicherung und die Verwendung absolut dicht sein. Auf diesem Gebiet sind wir Spezialisten.« Viele Interessenten hätten sich bereits bei nass magnet gemeldet und Muster der Ventile gekauft. Aber da das Thema in der Politik lange stiefmütterlich behandelt wurde, sei die Unsicherheit immer noch zu groß, um ein ernsthaftes Investment auszulösen. »Ich denke allerdings, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis jemand den ersten Schritt wagt«, sagt Kirchheim. »Die neue Bundesregierung zeigt sich technologieoffener und das ist auch ein Signal an die Industrie.«






















